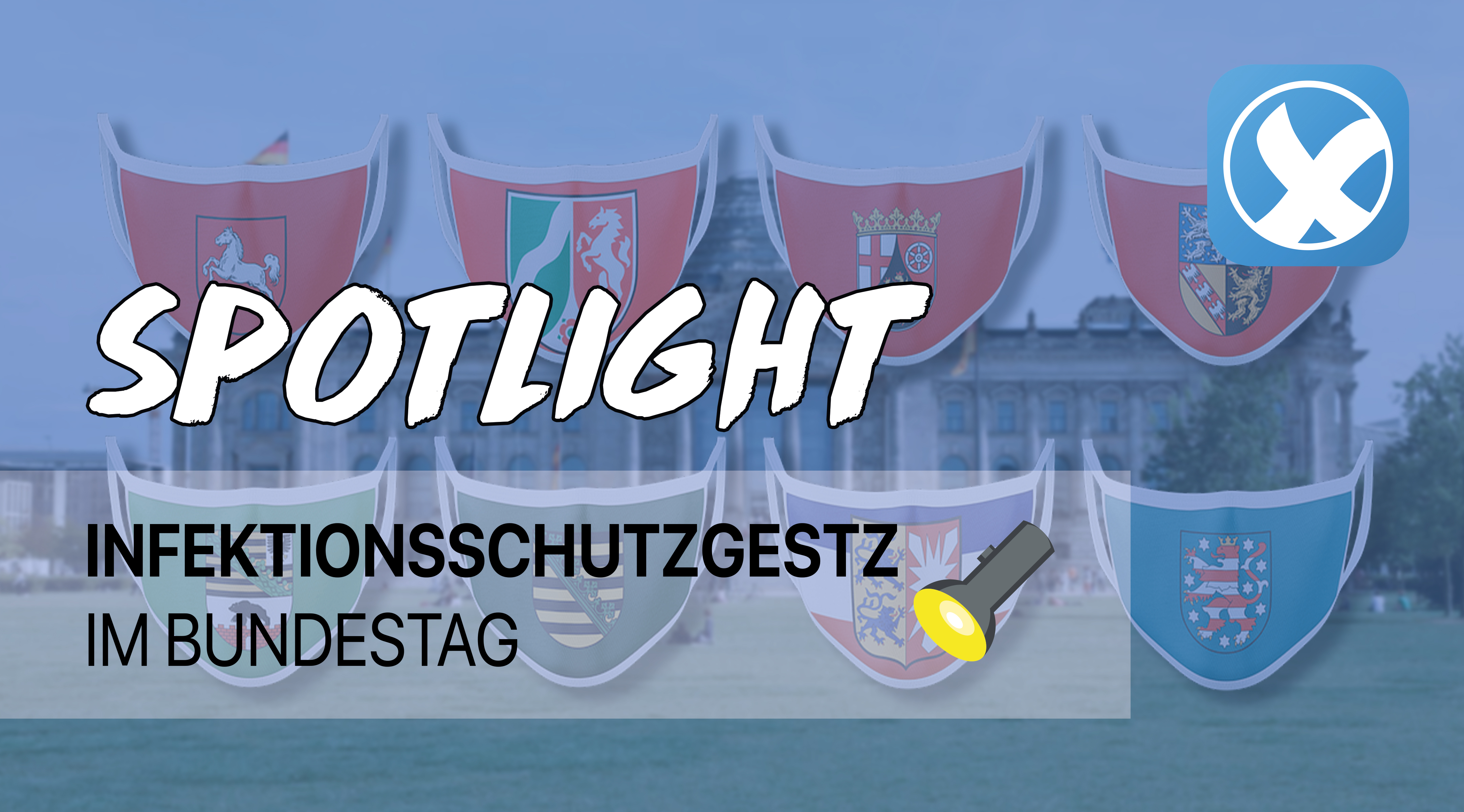Die Konferenz der Ministerpräsident:innen bestimmte ein Jahr lang die deutsche Pandemiebekämpfung, weil diese im deutschen Föderalismus erstmal Ländersache ist. Dadurch wurde die MPK regelmäßig zu einem Showdown, oder zumindest als solcher inszeniert. Meistens wurde erst spät in der Nacht ein Kompromiss gefunden. Am nächsten Tag verkündeten dann verschiedene Bundesländer die vielen Arten, auf die sie von diesem Kompromiss abweichen würden.
Die letzte MPK fand am 22. März statt. Auf dieser wurde im Angesicht steigender Inzidenzen eine sogenannte ‘Osterruhe’ beschlossen. Nur ein paar Tage später musste diese aber wieder gekippt werden, weil sie so kurzfristig nicht umsetzbar war. Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm den Fehler zwar auf sich, es folgte trotzdem starke Kritik am gesamten Format der MPK. In der Folge beschloss die Bundesregierung, nachdem die bereits Anfang März beschlossene Notbremse ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 seitens einzelner Kommunen und Ländern nicht konsequent umgesetzt wurde, einzelne Maßnahmen wie eben diese Notbremse über eine Änderung der Infektionsschutzgesetzes durchzusetzen. Soweit der Stand für alle beneidenswerten Menschen, die seit Monaten unter einem Stein gelebt haben.
In den letzten Wochen wurde ausführlich über das Für und Wider von mehr Zentralismus in der Pandemiebekämpfung diskutiert. Als Pro-Argument kann die zunehmende Frustration in der Bevölkerung angeführt werden. Gegen mehr Kompetenzen für den Bund wurde unter anderem damit argumentiert, dass Bundesländer und Kommunen flexibel sein sollten, da sie individuelle Situationen besser beurteilen und angehen könnten. Allerdings lässt sich nicht pauschal sagen, ob gesetzlich verpflichtende Maßnahmen von der Bundesebene diese Handlungsfreiheit tatsächlich nennenswert einschränken. Das hängt schließlich davon ab, was genau im Entwurf von Union und SPD steht, über den Mittwoch abgestimmt wird.
Das Infektionsschutzgesetz wurde zum letzten Mal im November reformiert, und zwar durch durch das Dritte, weshalb nun über den Gesetzentwurf eines ‘Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite’ abgestimmt wird. Während beim Vorgänger erstmals konkrete Maßnahmen beschlossen wurden, die verwendet werden dürfen, nennt der neue Entwurf Maßnahmen, die von einem Landkreis ab einer 7-Tage Inzidenz von 100 in drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens eingeleitet werden müssen – die Notbremse. Hier wird also nur gesetzlich festgeschrieben, worauf sich die MPK eigentlich schon Anfang März geeinigt hatte.
Wenn die Inzidenz unter 100 liegt, macht der Bund jedoch keine Vorgaben mehr. In Anbetracht zuvor verwendeter Schwellenwerte von 50 oder 35 scheint hier die Sorge um zu wenig Handlungsspielraum zunächst übertrieben. Darüber hinaus ist es schwierig, qualifizierte Stimmen zu finden von denen diese Notbremse als ausreichend wahrgenommen wird, um die dritte Welle zu brechen. Dagegen argumentieren beispielsweise Modellierer der TU Berlin, das Robert-Koch-Institut sowie Intensivmediziner:innen.
Anders sieht es bei der wohl umstrittensten Maßnahme aus dem Katalog im Gesetzentwurf aus, der Ausgangssperre. Es gibt durchaus Modellierungsstudien, die diesen einen Effekt zuschreiben und auch Hamburg kann als Positivbeispiel herangezogen werden. Der Sinn ist zwar nicht unbedingt abendliche Spaziergänge, sondern abendliche Spaziergänge in andere Privaträume zu unterbinden, auch wenn es dafür eben ein pauschales Verbot braucht. Trotzdem sprachen sich kürzlich Aerosolforscher:innen gegen diese Maßnahme aus, weil dadurch Menschen lediglich zu früheren Zeiten zu Treffen in Innenräumen gedrängt werden könnten, obwohl immer wärmere Temperaturen weniger gefährliche Zusammenkünfte draußen möglich machen. Die höhere Infektionsgefahr in Innenräumen ist unbestreitbar, auch wenn Infektionen, die draußen stattfinden weitaus schwerer nachzuverfolgen sind. Dieses Problem hatte eine Studie aus Irland.
Egal, wie man Ausgangssperren nun bewertet, in einem Punkt könnten sich verschiedene Standpunkte verbinden lassen. Es falle schwer, diese weitere Einschränkung des Privatlebens zu akzeptieren, wenn es weiterhin keine Pflicht zum Homeoffice für die Jobs gibt, bei denen es möglich ist. Das sagte die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt im Bundestag in der ersten Lesung am Freitag, als sie den aus ihrer Sicht zu zaghaften Umgang mit verbindlichen Regeln für Unternehmen anprangerte. Es sei außerdem keine langfristige Strategie mit genaueren Regelungen enthalten. Kritik für die Notbremse gab es auch von der FDP. Ihr Vorsitzender Christian Lindner merkte an, dass wichtige Differenzierungen im Gesetz fehlen, die bisher auf kommunaler Ebene vorgenommen wurden. Dazu gehöre eine Unterscheidung zwischen lokalen Ausbrüchen und einem breiten, diffusen Infektionsgeschehen. Lindner hält die Ausgangssperre für verfassungswidrig und kündigte deshalb eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an.
Bleibt der Entwurf in der jetzigen Form bestehen, wären solche Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht erstmals möglich. Selbst wenn das Gesetz durch den Bundestag geht und auch der Bundesrat in seiner Sondersitzung am Donnerstag keinen Vermittlungsausschuss anruft, wird das also voraussichtlich nicht das Ende vom Lied sein. Unabhängig davon, ob Ausgangssperren einen Effekt haben oder nicht – eine andere Frage ist es, ob der Effekt groß genug ist, dass ein so massiver Grundrechtseingriff legitim ist, wie auch die Rechtsanwältin Nina Diercks auf Twitter festhält. Schließlich muss nicht ihr Gelten, sondern der Eingriff in Grundrechte juristisch gerechtfertigt werden.
Die heiß geführt Debatte um Ausgangssperren ist scheibar auch an der Bundesregierung nicht vorbei gegangen. Laut neuesten geplanten Änderungen am Gesetz planen die Regierungsparteien, diese von 22 Uhr statt 21 Uhr bis 5 Uhr einzuführen. Weiterhin sollen Spaziergänge und Joggen noch bis 24 Uhr möglich sein. Selbst wenn die ursprünglich geplante Ausgangssperre also über die Einschränkung des Verkehrs zwischen privaten Innenräumen wirksam gewesen wäre, würde dieser Effekt dadurch wohl abgeschwächt. Außerdem soll die Notbremse bis zum 30. Juni befristet werden und die Rechtsverordnungen, die der Bund durch die Gesetzesänderung erlassen kann, müssen nicht nur Zustimmung im Bundesrat sondern auch im Bundestag finden.
Was trotz dieser potenziellen Änderungen bleibt, ist der Eingriff in die bisher föderal geprägte Logik der Pandemiebekämpfung ab einer Inzidenz von 100, bei der die Länder praktisch keinen Handlungsspielraum mehr haben. Da Maßnahmen ab diesem Schwellenwert aber voraussichtlich sowieso nicht ausreichen, wird es in der Krise auch weiterhin auf die 16 Ministerpräsident:innen ankommen.